Für alle Fragen rund um unsere Webseite, unsere Medien und Abonnements finden Sie hier den passenden Ansprechpartner:
Übersicht Ansprechpartner
Beitrag von Gudrun L. Töpfer und Sandra Bils aus managerSeminare 325, April 2025
Pro-Innovation-Dilemma: Warum der einseitige Hype ums Neue in die Irre führt
Folgenreicher Verzicht aufs Verzichten: Die Konsequenzen fehlender Exnovation
Exnovator's Dilemma: Warum Aufhören in Organisationen so schwerfällt
Achtsame Abschiede: Beispiele erfolgreicher Exnovation in Organisationen
Aufhören mit System: Worauf es beim Exnovieren ankommt
 Hier geht es zur gesamten Ausgabe managerSeminare 325
Hier geht es zur gesamten Ausgabe managerSeminare 325
Keine Frage, die Bühne gehört heute der Innovation. Innovativ zu sein, gilt als der Weg in eine erfolgreiche organisationale Zukunft. Der Managementdiskurs und der Führungsalltag sind dementsprechend voll von Innovationsmethoden und -modellen, Innovationswerkzeugen, Innovationsprojekten, Innovationsforschung, Innovationsliteratur, Innovationsworkshops, Innovationsplattformen und -foren. Dabei ist der Innovationsbegriff durchweg positiv besetzt: Neu gleich gut, so das verbreitete Verständnis. Besonders eindrückliche Beispiele dafür finden sich in der Medizin: Als neu gelabelte Medikamente und Behandlungsmethoden wurden in verschiedenen Vergleichsstudien auch dann als wirksamer beschrieben, wenn in Wahrheit weiterhin die alten Medikamente und Behandlungsmethoden eingesetzt wurden.
Doch gibt es bei aller Freude an Fortschritt und Zukunft eine Kehrseite: Die unreflektiert positive Sicht auf Innovationen wird in der Forschung als Pro-Innovation Bias bezeichnet. Besonders bedenklich ist diese Verzerrung, wenn eine Innovation Kollateralschäden mit sich bringt, die in der Begeisterung für das Neue nicht deutlich wahrgenommen werden. So bringen manche Innovationen zwar einem kleinen Kreis von Menschen Nutzen, während sie an anderer Stelle großen Schaden verursachen. Davon abgesehen führen viele Innovationsprozesse noch nicht einmal zu den konkret erwarteten positiven Veränderungen. Gerade bei komplexen Problemlagen ist immer wieder festzustellen, dass diese trotz neuer Produkte oder neuer Vorgehensweisen nicht in den Griff zu bekommen sind. Und das liegt nicht etwa daran, dass nicht intensiv genug an neuen Ansätzen gearbeitet würde. Es liegt daran, dass Innovationen zwar wichtig sind, aber gerade bei großen, komplexen Themen als Lösungsstrategie nicht ausreichen. Um solche Probleme zu lösen, bedarf es neben der Innovation einer weiteren komplementären Strategie: der Exnovation.
Innovationen sind wichtig, aber gerade bei großen komplexen Problemlagen als alleinige Lösungsstrategie nicht ausreichend. Um solche Veränderungen herbeizuführen, bedarf es neben der Innovation einer weiteren, komplementären Strategie: der Exnovation, also der Bereitschaft, etwas Bestehendes aufzugeben, ein Muster zu verlassen.
Exnovation ist der wissenschaftliche Begriff dafür, absichtlich mit etwas aufzuhören, etwas aufzugeben, ein Muster zu verlassen. Der US-amerikanische Managementprofessor John Kimberly, der den Fachterminus Anfang der 1980er-Jahre einführte, verstand Exnovation als finalen Schritt im Innovation Lifecycle: Eine ehemalige Innovation wird eingestellt, um Raum für neue Innovation(en) zu schaffen. Für diesen ewigen Kreislauf gibt es viele Vorbilder in der Natur – etwa das Ökosystem Wald, dessen Fortbestand auf Prozessen von Zersetzung und Wachstum beruht. Die ökologische Erkenntnis, dass Werden Vergehen voraussetzt, lässt sich auch für den Fortbestand anderer Systeme nutzen. Dafür aber ist die Akzeptanz der Exnovation als elementarer Schritt wichtig; Innovation allein reicht nicht.
mit unserer Testmitgliedschaft von managerSeminare:
für nur 10 EUR einen Monat lang testen
Zugriff auf alle Artikel von managerSeminare
Sofortrabatte für Bücher, Lernbausteine & Filme
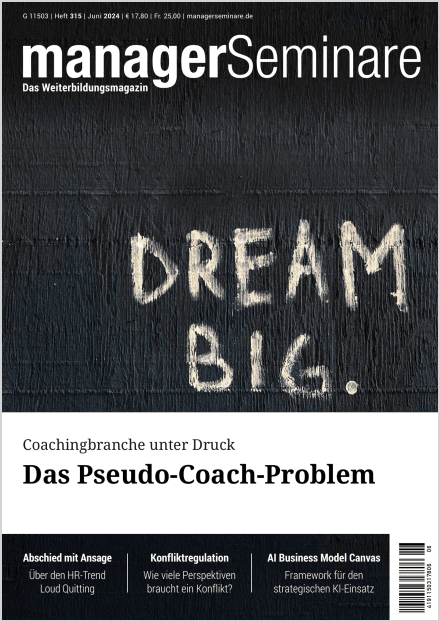
 Nach oben
Nach oben