Für alle Fragen rund um unsere Webseite, unsere Medien und Abonnements finden Sie hier den passenden Ansprechpartner:
Übersicht Ansprechpartner
Beitrag von Nicole Bußmann aus managerSeminare 321, Dezember 2024
Werdegang vom Arzt zum Organisationsberater: Grenzgänger zwischen den Disziplinen
Realistischer Zugang zu Veränderung: Wo die Vorteile systemischen Denkens in Therapie und Organisationsberatung liegen
Spannender Sonderfall: Forschungs- und Beratungsgegenstand Familienunternehmen
Vorteil der Abstraktion: Wie theoriegeleitetes Arbeiten die Praxis der Organisationsberatung verbessert
Kritik: Inwiefern ein Großteil der systemischen Beraterszene in Deutschland unterkomplex denkt und agiert
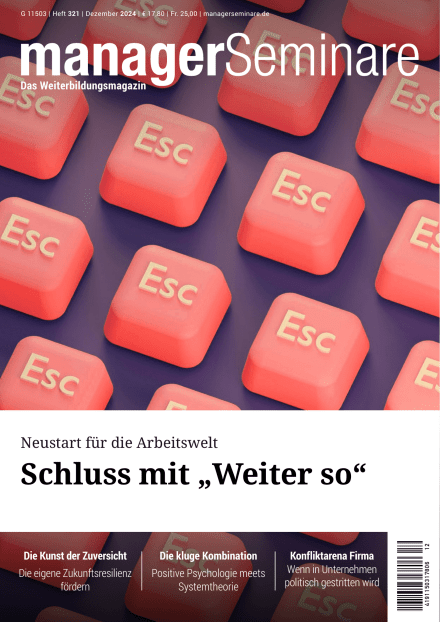 Hier geht es zur gesamten Ausgabe managerSeminare 321
Hier geht es zur gesamten Ausgabe managerSeminare 321
Herr Professor Simon, Sie werden mit dem Live Achievement Award ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen diese Würdigung?
Fritz B. Simon: Ich fühle mich ein bisschen bedroht. Ich habe nämlich schon einmal einen Preis für mein Lebenswerk erhalten. Und anschließend bin ich, ganz im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung, sehr krank geworden. Ich lag eine Woche im Koma. Seither reagiere ich auf Preise für mein Lebenswerk erst einmal ambivalent. Aber da ich danach noch einmal einen solchen Preis überlebt habe, werde ich den dritten wahrscheinlich auch überleben. Doch im Ernst, ich fühle mich natürlich sehr geehrt. Wobei ich ja gar nicht weiß, worin Sie mein Lebenswerk sehen ...
Worin sehen Sie selbst es denn?
Ich habe eigentlich noch nie darüber nachgedacht, was mein Lebenswerk ist. Denn ich habe mich mein Leben lang von meiner Neugierde treiben lassen. Ich bin ja Arzt, und ich fand es schon im Medizinstudium spannend, mir biologische Organisationsprozesse anzuschauen: Was ist im menschlichen Körper nötig, um bestimmte Funktionen aufrechtzuerhalten? Was mich dann aber besonders interessierte, waren Phänomene der psychischen Desorganisation. Also die Fälle, in denen Menschen nicht mehr denken und fühlen wie der Durchschnitt, sondern „verrückt“. Mag sein, dass hinter meinem Interesse für Verrücktheit auch eine Art persönlicher Problematik steckte; ich komme aus einer Familie, die mir in der Hinsicht gefährdet erschien. Aber Verrücktheit ist ja auch deshalb spannend, weil es zum Beispiel eine ungeheure Kreativität voraussetzt, ein Wahnsystem zu entwickeln. Außerdem stellt sich, wenn man sich mit Abweichung beschäftigt, sofort die Frage: Wie entsteht eigentlich Normalität? Abweichung und Normalität – diese beiden Themen haben mich seit jeher beschäftigt. Über sie bin ich dann auch relativ schnell bei der Familie gelandet und habe familientherapeutisch gearbeitet. Denn in Familien wird Menschen ja beigebracht, was „normales“ Denken und Fühlen ist. Mit dem Thema Familie ist man dann auch schnell bei sozialen Systemen im Allgemeinen. Da sind sie also – die drei Themen, die mich über die Jahre hinweg beschäftigt haben: Organisationsprozesse in biologischen, in psychischen und in sozialen Systemen. Vor allem hat mich die Frage umgetrieben: Was sind die Wechselbeziehungen zwischen diesen drei Systemtypen? Wie viel ich zum jeweiligen Feld beigetragen habe? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gelegentlich Dinge aus verschiedenen Fachgebieten zusammengebracht, sie in Relation gesetzt.
„Drei Themen haben mich über die Jahre hinweg beschäftigt: Organisationsprozesse in biologischen, in psychischen und in sozialen Systemen, gepaart mit der Frage: Was sind die Wechselbeziehungen zwischen diesen Systemtypen?“
Das sehe ich auch so, dass Sie ein Brückenbauer sind, einer, der sehr interdisziplinär gearbeitet hat. Was hat Sie daran besonders gereizt?
Es war nicht mein Plan, interdisziplinär zu arbeiten. Aber das Thema Organisationsprozesse liegt nun mal quer zu allen möglichen akademischen Disziplinen. Beschäftigt man sich damit, muss man notwendigerweise über die Grenzen des eigenen Fachgebiets hinausgehen und sich auch für andere Fachgebiete interessieren – was einen in den Augen der Vertreterinnen und Vertreter dieser Fachgebiete logischerweise verdächtig macht. Man wildert aus deren Sicht in fremden Revieren. Doch diesen Ärger muss man aushalten können als Organisationsforscher, und als solchen würde ich mich sehen.
Nicht als Arzt oder Psychoanalytiker?
Nein, nicht wirklich. Das sind natürlich alles Titel und Ehrenzeichen, die ich irgendwann erworben habe. Aber ich praktiziere in diesen Feldern ja nicht mehr. Ich könnte auf meine alten Tage zwar noch eine Praxis aufmachen, doch es war ja kein Zufall, dass ich mich von diesem Metier abgewandt habe. Ich bin nicht zuverlässig genug, um mich fünfmal in der Woche hinter eine Couch zu setzen und mir die Träume eines Patienten anzuhören. Wobei ich das in keiner Weise abwerten will, zumal ich selbst ein paar 100 Stunden auf der Couch gelegen habe und keine davon bereue. Natürlich, wo ich Eindruck schinden muss, da bezeichne ich mich auch heute noch als Psychoanalytiker, als Facharzt für dieses und jenes, aber letztlich sind mir diese Titel ziemlich wurscht, mich interessieren viel stärker die Inhalte.
Und über die Inhalte sind Sie auch auf Ihren späteren Schwerpunkt, die Organisationsberatung, gekommen?
Tatsächlich habe ich, noch lange bevor ich mich mit Familientherapie oder mit der Arbeit mit Teams beschäftigt habe, das Interesse an Organisationen entwickelt: als ich im Alter von 25 Jahren angefangen habe, als Arzt in einer psychiatrischen Großklinik zu arbeiten. Wir waren 1.300 Patienten und zehn Ärzte. Ich kam direkt von der Uni, hatte noch nicht viel Ahnung vom Arbeitsleben und musste gleich die Wachstation übernehmen. Da wurden zum Beispiel die Patienten aufgenommen, die von der Polizei eingeliefert wurden. Ich hatte dort eine ungeheure, mich verstörende Macht: Ich konnte Patienten ans Bett fesseln lassen, sie niederspritzen usw. Ich habe diese Machtfülle, die ich gar nicht haben wollte, zunächst überlebt, weil ich schlau genug war, die leitenden Pfleger und Schwestern, die schon lange im Dienst waren, zu fragen, was ich tun soll. Das hat mich aber nicht befriedigt. Ich habe mich gefragt: Was passiert hier? Was mache ich hier eigentlich? Und welche Erklärungen könnten mir helfen, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen? Irgendwann hat mir eine Freundin und Kollegin das Buch „Lösungen“ von Paul Watzlawick geschenkt. Als ich es zur Hälfte gelesen hatte, wusste ich: Watzlawicks kommunikationstheoretischer Ansatz liefert mir passende Erklärungen für das, was in der Klinik geschieht. Er rekurrierte nicht auf die frühe Kindheit des Patienten. Das erklärte ja auch nicht, warum ein Patient gerade jetzt tobt.
Welche Erklärung lieferte Ihnen Watzlawick stattdessen?
Watzlawick eröffnete mir, auch durch seine weiteren Schriften, die Perspektive, dass psychische Störungen auch als eine Antwort auf das soziale System, in dem sich ein Mensch bewegt, zu verstehen sind. Dass sie eine womöglich dysfunktionale, aber aus Perspektive des Klienten vernünftige Reaktion auf die Struktur sind, in der er sich bewegt. Als ich etwas später mit einem kleinen Team eine Station nach eigenen Vorstellungen aufbauen durfte, habe ich diesen, wie man heute sagen würde, systemischen oder systemtheoretischen Ansatz angewendet und bin auch später immer wieder darauf zurückgekommen. Etwa in der Familientherapie, als ich in Heidelberg gemeinsam mit Helm Stierlin, Gunthard Weber und Gunther Schmidt gearbeitet habe. Und natürlich in der Organisationsberatung.

Wie genau kam es dann zum Schritt von der Therapie in die Beratung von Organisationen?
In der Zeit, in der ich in Heidelberg therapeutisch mit Familien gearbeitet habe, habe ich in Österreich viele Gruppendynamiktrainings geleitet, in denen Therapeuten und Organisationsberater aufeinandertrafen. Irgendwann kamen die Organisationsberater (in erster Linie Mitglieder von Wiener Beratungsfirmen) auf mich zu und baten mich, ihnen beizubringen, was wir in der systemischen Familientherapie machten. Sie interessierten sich vor allem für unser Interventionsrepertoire. Daraus entwickelte sich eine ständige Beziehung. In den 1980er-Jahren habe ich mit fast allen einschlägigen Wiener Organisationsberatungsfirmen zusammengearbeitet, habe dort Supervisionen durchgeführt und war in diverse Projekte der Firmen eingebunden. Irgendwann wurde ich dann von einer selbstorganisierten Gruppe erfahrener Berater aus Österreich, der Schweiz und Deutschland gebeten, ein Seminar zum Thema zu veranstalten. Das machte ich mit Gunthard Weber – und daraus wurde dann aufgrund der Nachfrage unser systemisch orientiertes Beratungsunternehmen „Simon Weber Friends“; wir waren damit wohl die Ersten, die systemische Organisationsberatung als Weiterbildung angeboten haben. Was für mich auf meinem Weg in die Beratung damals übrigens besonders überraschend war: Als ich zum ersten Mal ein Seminar mit Wiener Organisationsberatern durchführte und wir dabei auch Familieninterviews simulierten, verstanden diese Berater sehr viel besser als die meisten Psychologen, die ich sonst in Seminaren hatte, was systemische Therapeuten tun.
Woher kam dieser Eindruck?
Es gab da einen Kern von Personen, die sich für Systemtheorie interessierten, vor allem für die von Niklas Luhmann. Er verstand soziale Systeme als Kommunikationssysteme. Seine Arbeiten kannte ich, weil ich mich in meiner Zeit als Arzt in der Psychiatrie mit den Themen Kontrolle und Vertrauen beschäftigt hatte (siehe zu dem Thema auch Teil zwei des Interviews mit Fritz B. Simon in managerSeminare 322). Auch diese Berater waren an den Mustern der Kommunikation interessiert, während viele Psychologen von der Komplexität von Mehrpersonensystemen überfordert waren. Denn Psychologen versuchen primär, ein Individuum zu verstehen, was ja schon komplex genug ist. Wenn man aber nicht nur eine Person verstehen will, sondern fünf in Interaktion miteinander, dann fliegt einem die Komplexität um die Ohren. Verlegt man sein Interesse dann jedoch von der Psyche auf die Regeln der Interaktion bzw. die Kommunikationsmuster, wird es viel einfacher. Und es ist auch einfacher, ein Kommunikationsmuster zu verändern, als zu versuchen, die Psyche eines Menschen zu verändern.
„Es ist einfacher, ein Kommunikationsmuster zu verändern, als zu versuchen, die Psyche eines Menschen zu verändern.“
Menschen zu verändern, ist relativ schwer. Kommunikationsmuster dagegen sind, vereinfacht gesagt, nichts anderes als Spielregeln. Und Menschen können unterschiedliche Spiele spielen. Jemand kann Schach spielen und Basketball, ohne dass er deswegen seine Persönlichkeit verändern muss; er oder sie muss nur die Spielregeln lernen. Auch, wer in einer Organisation neu anfängt, muss zunächst einmal die Spielregeln lernen. Und auch hier gilt: Es ist sehr viel einfacher, zu schauen, welche Spielregeln dysfunktional und welche funktional sind, als auf die Psyche der Organisationsmitglieder zu schauen.
Paul Watzlawick und Niklas Luhmann, auf deren Ideen diese Sichtweise zurückgeht, haben Sie auch persönlich kennengelernt. Wie haben Sie die beiden erlebt?
Paul Watzlawick habe ich kennengelernt, nachdem er einen Artikel über paradoxe Kommunikation gelesen hatte, den ich mit zwei Kolleginnen geschrieben hatte, und er ganz begeistert war. Von da an entwickelten wir eine enge Beziehung und arbeiteten eng zusammen, Paul wurde sogar zu einer Art Mentor für mich. Ich habe ihm und auch Heinz von Foerster sehr viel zu verdanken. In den 1980er-Jahren habe ich mit den beiden regelmäßig in Palo Alto zusammengearbeitet und Seminare durchgeführt. Das war eine echte Weichenstellung in meinem Werdegang. Ich war etwa Mitte 30, Heinz von Foerster war 74 und Paul 64 Jahre alt. Doch die beiden behandelten mich auf Augenhöhe. Denn ich konnte die Praxis beisteuern, die ihnen, mehr oder weniger, fehlte. In Palo Alto ist auch die Idee entstanden, dass wir uns die verschiedenen systemtheoretischen Ansätze und ihre Relevanz für die Praxis aus diversen Fachperspektiven genauer anschauen sollten. 1986 habe ich dann in Heidelberg eine Tagung organisiert, zu der unter anderen Niklas Luhmann, Heinz von Foerster und der Biologe und Neurowissenschaftler Francisco Varela kamen. Varelas und Maturanas Autopoiesis-Idee hatte da gerade ihren Siegeszug begonnen. Es war eine wunderbare Veranstaltung. Wir haben dort u.a. Videos von Familientherapiesitzungen gezeigt – und das Bemerkenswerte war, dass Niklas Luhmann sofort verstand, was wir als Therapeuten taten, während die anderen beiden viel größere Schwierigkeiten damit hatten. Denn Luhmann schaute auf die Kommunikation und merkte sofort, dass wir zum Beispiel versuchten, Attribution zu verändern, d.h. mit Umdeutungen arbeiteten.
Das heißt …?
Wie ein Beobachter etwas, das er wahrnimmt, erklärt und bewertet, hängt davon ab, vor welchem theoretischen Hintergrund er dies tut. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, jemand verhält sich auf eine bestimmte Weise, weil er früher bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Oder, ob ich sage, er verhält sich auf diese Art, weil das für ihn in diesem Moment gerade sinnvoll ist – ob man es nun als dysfunktional deutet oder als echte Lösung. Luhmann konnte das sofort nachvollziehen. Er war dann später auch noch öfter bei uns in Heidelberg. Was Organisationen angeht, kommt man an ihm nicht vorbei, denke ich. Wobei auch er auf andere Organisationsforscher zurückgriff, James March und auch Herbert Simon zum Beispiel. Doch Luhmanns Verdienst ist es, dass er mit seiner Gesellschaftstheorie ein sehr konsistentes Modell erschaffen hat und u.a. den Blick dafür schärfte, dass das soziale System Organisation anders funktioniert als das System Familie.
„System- und Kommunikationstheorie sind sehr abstrakt. Doch gerade deswegen sind sie so etwas wie der universale Verständnisrahmen für alle Gelegenheiten.“
Ein sehr wichtiger Punkt, dass Familien und Organisationen nicht dasselbe sind. Gerade beim Wort systemisch scheinen viele da ja einiges zu verwechseln …
Ja, wer wie ich aus der Therapie kommt, meint ja oft, man könne eine Organisation verändern, indem man so interveniert wie man auch in Paar- oder Familienbeziehungen oder kleinen Teams interveniert. In den 1970er-Jahren hat man das in der Gruppendynamik genau so getan. Da hat man Organisationen als Ansammlungen von Gruppen betrachtet, mit diesen gearbeitet und gemeint, dadurch die Organisation verändern zu können. Aber eine Organisation ist keine Gruppe und schon gar nicht eine Familie. Im Gegenteil: Wenn in einer Organisation jemand sagt „Wir sind eine große Familie“, dann sollten sofort die roten Lampen angehen oder zumindest die gelben. Denn dann hat er oder sie etwas durcheinandergebracht, was differenziert betrachtet werden muss.
Was genau unterscheidet das System Familie vom System Organisation?
Ganz grob skizziert: In einer Familie ist die Kommunikation personenorientiert und ändert sich daher im Lauf der Familiengeschichte. Wenn etwa ein Großvater dement wird, verändern sich in der Familie die Interaktions- und Kommunikationsmuster. Sie sind relativ flexibel, aber die Personen bleiben relativ konstant. In einer Organisation dagegen haben die Menschen, die dort arbeiten, zwar auch persönliche Beziehungen. Das sieht man bei jedem Meeting, wo alle erst einmal darüber reden, wie ihr Wochenende war, bis jemand sagt: Lasst uns zur Sache kommen. Ab da wird das getan, was in der Organisation im Idealfall vorherrscht: Es wird sachorientiert kommuniziert. Denn es geht darum, sachliche Aufgaben zu erledigen. Die Logik ist also im Gegensatz zur Familie eher von einer sachlichen Aufgabe als von persönlichen Bedürfnissen bestimmt. Die Kommunikation ist sach- und nicht personenorientiert. Die Kommunikationsmuster bleiben der Aufgabe gemäß relativ konstant, aber die Personen, die Funktionsträger, sind austauschbar.
„Wenn in einer Organisation jemand sagt ,Wir sind eine große Familie', sollten sofort die roten oder zumindest die gelben Lampen angehen. Denn da hat jemand etwas durcheinandergebracht, was differenziert betrachtet werden muss. Organisationen und Familien funktionieren nach unterschiedlichen Logiken.“
Als Berater haben Sie sich allerdings auch intensiv mit Familienunternehmen beschäftigt, also mit einer Betriebsform, in der beide Systeme – Familie und Organisation – zusammenkommen.
Ja, das war tatsächlich sehr reizvoll für mich und Rudi Wimmer. Mit ihm gemeinsam habe ich ja in Witten einen Lehrstuhl und ein Institut mit dem Forschungsgegenstand Familienunternehmen aufgebaut. Rudi war seit Jahren Organisationsberater, und ich war jemand, der sich als Therapeut seit Jahren mit Familien beschäftigt hatte. Doch wir hatten beide dasselbe theoretische Fundament – systemtheoretische Konzepte von Unternehmen und Familien. Da kamen also zwei Seiten konstruktiv zusammen. Denn man kann Familienunternehmen in der Tat nur dann richtig verstehen, wenn man erkennt, dass da zwei soziale Systeme miteinander gekoppelt sind, die einer unterschiedlichen Funktions- und Entscheidungslogik folgen. In der Familie dreht sich alles darum, dass es den Personen gut geht – und deswegen ändert man gelegentlich auch mal ein Prinzip, nach dem man Entscheidungen trifft. Ein Unternehmen wiederum hat das Ziel, sein Überleben auf irgendeinem Markt zu sichern – weshalb seine Entscheidungsprämissen nicht einfach verändert werden können, nur damit es einzelnen Personen gut geht. Familienunternehmen kann man nur verstehen, wenn man um diese verschiedenen Logiken und die daraus resultierenden Paradoxien weiß; aber auch darum, dass sich im Familienunternehmen die beiden Systeme mit ihren Spielregeln und ihren Werten beeinflussen. Unternehmerfamilien funktionieren anders als andere Familien. Und Familienunternehmen funktionieren anders als börsennotierte Unternehmen. Nur wenn man sie vor dieser Folie analysiert, kann man sie verstehen. Ich denke, das war unser Beitrag – der in Witten nun auch von unseren Nachfolgern weiterverfolgt wird. Bis wir damit begonnen hatten, uns wissenschaftlich mit dem Thema zu befassen, gab es im deutschsprachigen Raum übrigens so gut wie keine Forschung dazu.
Also haben Sie Pionierarbeit geleistet, was das Verständnis von Familienunternehmen angeht?
Ja, ich denke schon, in aller Bescheidenheit. Dabei hatten wir gar nicht vor, Pionierarbeit zu leisten. Wir haben nur versucht, unseren Job zu machen. Aufgrund der theoretischen Konzepte, die wir hatten, war das eher logisch.
Stichwort Theorie: Systemtheorie, gerade die von Luhmann, ist bekanntlich ein harter Brocken, sprich: für Laien erst mal recht schwer zu verstehen. Wie gelingt es überhaupt, derart abstrakte Modelle in die Praxis zu bringen?
Indem man nicht über Systemtheorie redet. Ich bin ja selbst ein Praktiker, der über die Not der Praxis zu den Theoriefragen gekommen ist. Und die Systemtheorie hat mir gerade deswegen geholfen, weil sie sehr abstrakt ist. Man kann sie grundsätzlich auf nicht kalkulierbare Situationen anwenden. Ob man als Therapeut oder Organisationsberater mit einem Kundensystem arbeitet: Man kann nie vorhersagen, was passieren wird. Man hat keine Kontrolle über die Situation, muss aber trotzdem in der Situation agieren und zwar zielgerichtet und sinnvoll, um dem Auftrag gerecht werden zu können. Also braucht es eine Theorie, die so abstrakt ist, dass sie auf möglichst alle denkbaren Situationen angewandt werden kann. Es ist in etwa so, wie ein Segler sich mit den Regeln der Navigation auskennen muss, wenn er seinen Zielhafen erreichen will, obwohl er weder Wind noch Seegang kontrollieren kann. Genauer gesagt: Man braucht in unseren Jobs ein Reflexionsinstrument, das es ermöglicht, zumindest hinterher herauszufinden, warum die Sache schiefgelaufen ist oder warum überraschenderweise etwas Positives passiert ist. Dabei hilft ein abstraktes Instrumentarium. Und System- und Kommunikationstheorie sind sehr abstrakt. Sie sind so etwas wie der universale Verständnisrahmen für alle Gelegenheiten. Denn alle sozialen Systeme, ob Familien oder Organisationen, sind Kommunikationssysteme. Deswegen kann man sich auch alle potenziellen Tools vor dem Hintergrund des systemtheoretischen Verständnisrahmens anschauen und sich fragen, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Das ist der große Vorteil der Abstraktion. Je konkreter dagegen ein Modell ist, nach dem man agiert, umso leichter mag es zwar zunächst erscheinen, es einzusetzen, aber umso begrenzter ist auch die Gültigkeit.
„Viele in der Szene nutzen den Begriff systemisch als Formel für die simplifizierende ,Weisheit', dass ,alles mit allem irgendwie zusammenhängen tut' – mit Betonung auf tut.“
Wie erklären Sie sich, dass die Systemtheorie aktuell wieder sehr en vogue ist?
Sie ist einfach das intelligenteste Angebot auf dem Markt. Wobei die Gefahr darin besteht, dass man sie missversteht, genauer: dass man sie als Methode missdeutet. Aber Systemtheorie ist keine Methode, sondern ein abstrakter Theorierahmen, in den man alle anderen Methoden einordnen kann. Gleichzeitig ist sie eine praktisch sehr nützliche Theorie, die das Leben viel einfacher macht. Denn man braucht nicht mehr tausend verschiedene Theorien, um die Dinge zu durchdringen. Für alle, die ökonomisch denken, gibt es nichts Schlaueres.
Wo Sie gerade Missverständnisse in Bezug auf Systemtheorie ansprechen: Was beobachten Sie aktuell in der deutschen Beraterszene, die sich systemisch nennt?
Es gibt tatsächlich unendlich viele Beraterinnen und Berater, die sich systemisch nennen und sogenannte systemische Kurse anbieten. Ich kenne einige von ihnen. Meine Kurse haben, glaube ich, mittlerweile 1.200 Personen durchlaufen. Und viele von ihnen haben danach angefangen, selbst systemische Seminare und Beratung anzubieten. Bei vielen merke ich „Ah, da hat jemand kapiert, worum es geht“, was mich natürlich freut. Aber viele andere in der Szene nutzen den Begriff systemisch als Formel für die simplifizierende „Weisheit“, dass „alles mit allem irgendwie zusammenhängen tut“ – mit Betonung auf „tut“. Es gibt da viele, die, wie ich finde, unterkomplexe Modelle vertreten.
„Es gibt in der Szene der sich systemisch nennenden Beraterinnen und Berater viele, die unterkomplexe Modelle vertreten. Doch man kann in Organisationen nicht sinnvoll systemisch arbeiten, wenn man sich nicht mit Organisationstheorie auseinandergesetzt hat.“
Ich möchte hier niemanden abwerten. Aber ich will doch darauf hinweisen: Man kann meines Erachtens in Organisationen nicht sinnvoll systemisch arbeiten, wenn man sich nicht mit Organisationstheorie auseinandergesetzt hat. Um es noch einmal ganz klar zu sagen: Wer nur mit personorientierten, etwa auf Teams bezogenen Modellen arbeitet, wer sich nur interpersonelle Kommunikation anschaut, der oder die versteht Organisationen nicht und springt zu kurz.
„Wer nur mit personorientierten, etwa auf Teams bezogenen Modellen arbeitet, wer sich nur interpersonelle Kommunikation anschaut, der oder die versteht Organisationen nicht und springt zu kurz.“
Daher sollte man bei der Auswahl einer Ausbildung, etwa als systemischer Berater, als systemische Beraterin, die Augen aufhalten: Hat der Anbieter tatsächlich ein organisationstheoretisches Verständnis oder nicht? Es gibt natürlich unterschiedliche Organisationstheorien, ich will jetzt gar nicht die von Luhmann allein herausstreichen, zumal er, wie gesagt, seine Modelle auch zum Teil von anderen übernommen hat. Aber: Man braucht ein Verständnis der Organisation als spezifischem sozialen System. Sonst kann man aus meiner Sicht in bzw. mit einer Organisation nicht seriös arbeiten.
In der nächsten Ausgabe erscheint ein weiteres Interview mit Fritz B. Simon, dann zum Thema Führung und Vertrauen.

Sie möchten regelmäßig Beiträge des Magazins lesen?
Für bereits 10 EUR können Sie die Mitgliedschaft von managerSeminare einen Monat lang ausführlich testen und von vielen weiteren Vorteilen profitieren.
 Nach oben
Nach oben